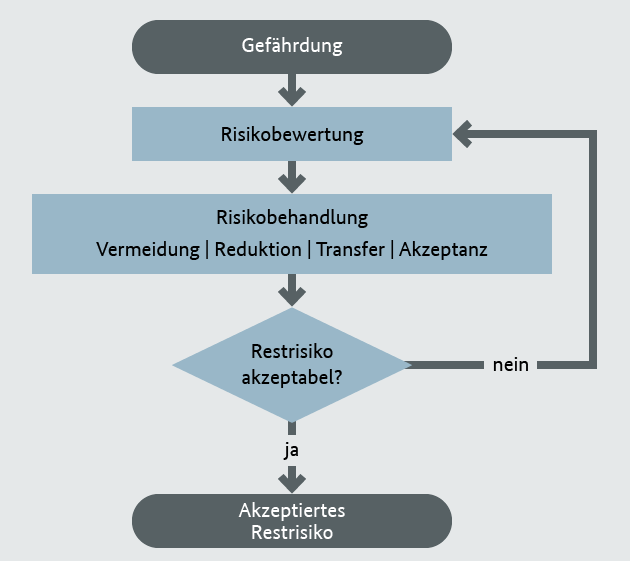Ziele gemäß Rahmenlehrplan
-
Mit Hilfe einer
RisikoanalysedenSchutzbedarfeines vernetzten Systems ermitteln undSchutzmaßnahmenplanen, umzusetzen und dokumentieren -
Auf Kundengespräch zur Identifizierung eines
Schutzbedarfesvorbereiten- Informieren über Informationssicherheit in vernetzten Systemen
-
Im Kundengespräch die
Schutzzieleermitteln, analysieren der Systeme hinsichtlich derAnforderungen an die Informationssicherheitundbenennen von Risiken -
Unter Beachtung
betrieblicher IT-Sicherheitsleitlinienundrechtlicher RegelungendieVorkehrungen und Maßnahmen zur Minimierung der Wahrscheinlichkeit eines Schadenseintrittsplanen -
Implementieren der Maßnahmen unter Berücksichtigung
technischer und organisatorischer Rahmenbedingungen -
Prüfen der Sicherheit des vernetzten Systems und bewerten des erreichten
Sicherheitsniveausin Bezug auf dieKundenanforderungen, eingesetzterMaßnahmenundWirtschaftlichkeit- Erstellen einer Dokumentation
- Informieren des Kunden über die Ergebnisse der
Risikoanalyse
-
Reflektieren des Arbeitsprozesses hinsichtlich möglicher
Optimierungen- Diskutieren des Ergebnisses in Bezug auf den Begriff der
relativen Sicherheitdes vernetzten Systems
- Diskutieren des Ergebnisses in Bezug auf den Begriff der
Empfohlene Materialien
Hackerethik
Die ethischen Grundsätze des Hackens – Motivation und Grenzen:
- Der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein.
- Alle Informationen müssen frei sein.
- Mißtraue Autoritäten – fördere Dezentralisierung.
- Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut, und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung.
- Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen.
- Computer können dein Leben zum Besseren verändern.
- Mülle nicht in den Daten anderer Leute.
- Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen.
Sicherheitslücke gefunden... und nun?
Plan
Zeitplan
siehe Ilias
Leistungskontrollen
-
Fr 28.11. Klassenarbeit: doppelte Wertung, 90min, handschriftlich
- Erlaubte Hilfsmittel: A4 Factsheet einseitig
- Themen: Alles was im Unterricht in der KW48 behandelt wurde…
- Schwerpunkte:
- Datenschutz & Datensicherheit: Begriffsunterscheidung
- Datenschutz: 2 besonders relevante Gesetze
- Prinzipien: Verbot mit Erlaubnisvorbehalt, Zweckbindung
- Datensparsamkeit: Privacy by Default, Privacy by Design, Anonymität, Pseudonymität
- Datensicherheit: Safety vs. Security, Schutzziele / Hauptziele / Grundwerte, Relative Sicherheit, „Stand der Technik“, Qualität
- Sicherheitsmanagement: ISO 27001, IT-Grundschutz-Methodik
- Datenschutz: 2 besonders relevante Gesetze
- Gefährdungen: Malware, Ransomware, Würmer, Trojaner, Phishing, Spear-Phishing, DoS, DDoS
- TOM (verstehen)
- Endgerätesicherheit (Maßnahmen beschreiben)
- Grundlagen Authentifizierung
- Grundlagen Kryptographie
- IT-Grundschutz-Methodik: Basis-, Kern-, Standard-Absicherung
- Vorgehen
- Schutzbedarfsanalyse
- Risikoanalyse
- IT-Grundschutz-Check (Nutzung von IT-Grundschutz-Bausteinen, Arbeiten mit Checklisten)
- Datenschutz & Datensicherheit: Begriffsunterscheidung
-
zweite Klassenarbeit => 19.12. (AE) bzw. 09.01. (SI)
-
Projektarbeit:
Bonus
=> Bei Interesse bitte melden
- Weitere Praxisbeispiele
- Hackerethik (vs. 202c StGB)
- CTF
-
„Live Hacks“ z.B.
- SQL-Injection
-
Netzwerksicherheit
- MITM-Proxy
- NMap
- Wireshark / TCPdump
- Binary Exploitation
Grundlagen
Datenschutz
- Individueller Schutz der Privatsphäre
- Schutz von gesellschaftlichen Grundwerten
Gesetze
- Bundesdatenschutzgesetz (BDSG)
- Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) / General Data Protection Regulation (GDPR)
Verbreitete Ursachen für Sicherheitsprobleme (Angriffsvektoren/Bedrohungsszenarien)
„Layer 8-10 Probleme“
Social Engineering
Phishing
Spear Phishing
Baiting („ködern“)
Dumpster Diving
Identitätsmissbrauch
Digitale Erpressung (Ransomware)
Sabotage / Vandalismus
Katastrophen
Security Misconfiguration
Broken Access Control
Vulnerable and Outdated Components
Designfehler / Protokollfehler
Identification and Authentication Failures
Man-in-the-middle attack
Sensitive Data Exposure
Software and Data Integrity Failures
In-band signaling
Resource exhaustion
(Distributed) Denial of Service
Amplification Attack
Cache Poisoning
Binary Exploitation
Web Exploitation
Cross Site Scripting (XSS)
Cross Site Request Forgery (CSRF)
Server Side Request Forgery
Security Logging and Monitoring Failures
…
siehe auch:
Maßnahmen / Werkzeuge
IT-Grundschutz-Bausteine
IT-Grundschutz-Kompendium
Technische Maßnahmen
Endpoint Security
Kryptographische Primitiven
Organisatorische Maßnahmen
Begleitende Maßnahmen
Grundprinzipien
Relative Sicherheit
Defense in depth / Schweizer-Käse-Modell
KISS-Prinzip

Security by design, Security by default
Technischer Datenschutz, Multilaterale Sicherheit
Kerckhoffs’ Prinzip
Schlangenöl
IT-Sicherheit vs. CYBER-Security
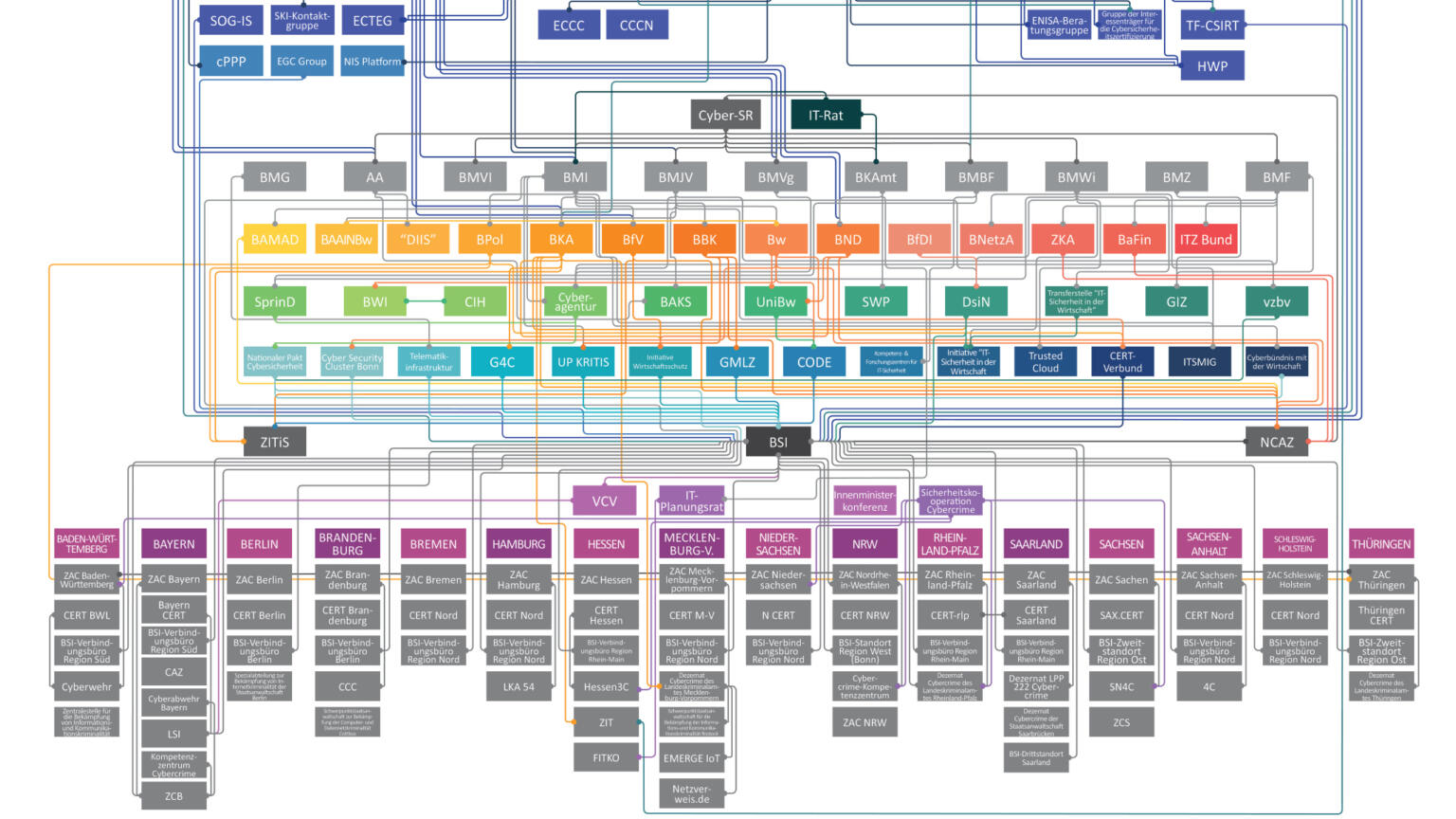
Frage 1: Was ist „CrowdStrike“?
Frage 2a: Was ist „Kaspersky“?
Frage 2b: Was sollte man über Kaspersky wissen?
Frage 2c: Welche Kaspersky Produkte werden für US-Nutzer empfohlen?
Frage 3a: Was haben CVE-2024-7479, CVE-2024-52940 und CVE-2024-12754 gemeinsam?
Frage 3b: Wieviele verschiedene Remote-Access-Tools haben Unternehmen im Jahr 2024 durchschnittlich eingesetzt?
Frage 3c: Was ist Telnet?
Frage 4a: Wie hilft KI Systeme sicherer zu machen?
Frage 4b: Wie hilft KI gegen den Klimawandel?
Frage 4c: Welches Geschäftsmodell hat OpenAI?
Threat Models == Bedrohungsszenarien
| Szenario | Angreifer | Beispiel für typische betroffene Nutergruppe |
|---|---|---|
| Massenüberwachung, Phishing | hoch automatisiert | ohne konkretes Ziel; besonders Schwach geschützte Opfer |
| Zielgerichtete Angriffe | fähig, verfügt über Geld und Personal | Unternehmen, AktivistInnen |
| Nationalstaaten | Geheimdienste | Snowden, Wikileaks, … |
Kritis & Hybride Kriegsführung
Grundlagen Kryptografie
BSI TR-02102 „Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen“
Verschlüsselung
Symmetrisch
Polyalphabetische Ersetzungschiffren (z.B. Vigenère-Chiffre)

WETTERVORHERSAGEBISKAYA (Klartext1)
+ NGMNIAKRBOGPITRFMEORCBI (Schlüssel)
= JKFGMRFFSVKGATXJNMGBCZI (Ciphertext1)
IUZOMFOYMGNPJXIIQVGZEIM (Ciphertext2)
Aufgabe 1: Angenommen, du hast obrige beiden Ciphertexte empfangen, den Klartext1 erraten und damit den „Tagesschlüssel“ berechnet (known-plaintext attack). Entschlüssel Ciphertext2 (z.B. mittels Tabula recta)
Aufgabe 2: Wie kann diese Art von Angriff verhindert werden?
One-Time-Pad
AES
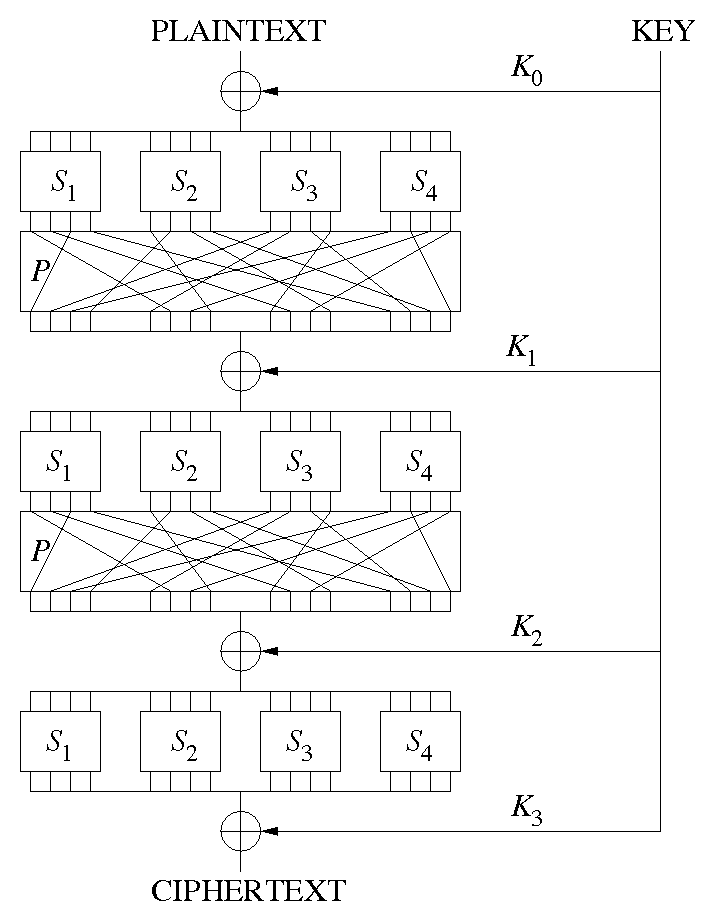
Asymmetrisch
Schlüsselaustausch
Diffie-Hellman
sequenceDiagram
Alice->Bob: p=23, z=7
Note left of Alice: a=3
Alice->>Bob: A = z^a mod p = 7^3 mod 23 = 21
Note right of Bob: b=4
Bob->>Alice: B = z^b mod p = 7^4 mod 23 = 9
Note left of Alice: k = B^a mod p = 9^3 mod 23 = 16
Note right of Bob: k = A^b mod p = 21^4 mod 23 = 16
Signaturen
(Kryptographische) Hashes
Anforderungen:
- Feste Länge der Hash-Werte
- Einweg-Funktion („Falltür-Funktion“)
- „Kollisionsfreiheit“ / „Kollisionsresistenz“

Key Management == Schlüsselverwaltung
Herausforderungen
- Schlüsselgenerierung
- Schlüsselspeicherung
- Schlüsselverteilung
Key Distribution
Von wo können wir öffentliche Schlüssel beziehen und woher wissen wir, dass sie wirklich zu der Entität gehören, mit der wir kommunizieren wollen???
Verschiedene Ansätze:
- Trust on first use / Autocrypt
- Individuelle Überprüfung
- Web of Trust
- Certificate authority == Zertifizierungsstelle
- Wer betriebt die CA???
Wo werden die verschiedenen Ansätze verwendet?
Welche Vor- und Nachteile haben die verschiedenen Ansätze?
Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)
14 „Anforderungen an die Sicherheit der Datenverarbeitung“ nach § 64 BDSG
| TOM | Beschreibung | Beispiele |
|---|---|---|
| Speicherkontrolle | Verhinderung unbefugter Kenntnissnahme, Eingabe oder Veränderung personenbezogener Daten | |
| Datenträgerkontrolle | Verhinderung unbefugten Lesens (Kopierens) oder Veränderns von Datenträgern | |
| Eingabekontrolle | Gewährleistung der Überprüfbarkeit, von wem und wann personenbezogene Daten eingegeben wurden | |
| Transportkontrolle | Gewährleistung von Vertraulichkeit und Integrität bei Übermittlung personenbezogener Daten | VPN; Verschlüsselung |
| Übertragungskontrolle | Gewährleistung der Überprüfbarkeit, an welche Stellen personenbezogene Daten übermittelt wurden (werden können) | Protokollierung übertragener Daten |
| Benutzerkontrolle | Verhinderung der Nutzung von Verarbeitungssystemen durch Unbefugte | |
| Zugangskontrolle | Verwehrung des Zugangs zu Verarbeitungsanlagen für Unbefugte | Schließsystem; Absicherung alternativer Zugänge; Verhaltens-, Aufsichtsregeln; Personalauswahl |
| Zugriffskontrolle | Gewährleistung, dass Zugriff gemäß Berechtigungen eingeschränkt ist | Benutzerkonten; Zugriffsrechte; Zugriffsprotokollierung; Hardwareausmusterung |
| Auftragskontrolle | Gewährleistung, dass im Auftrag verarbeitete personenbezogene Daten nur entsprechend Weisungen verarbeitet werden | |
| Verfügbarkeitskontrolle | Gewährleistung des Schutzes persönliche Daten vor Zerstörung oder Verlust | |
| Zuverlässigkeit | Gewährleistung, dass Systemfunktionen zur Verfügung stehen und Fehlfunktionen gemeldet werden | |
| Wiederherstellbarkeit | Gewährleistung, dass eingesetzte Systeme im Störungsfall wiederhergestellt werden können | |
| Datenintegrität | Gewährleistung, dass personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktionen beschädigt werden können | |
| Trennbarkeit | Gewährleistung, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene personenbezogene Daten getrennt verarbeitet werden können |
Analyse
Grundlegende Definitonen nach BSI-Grundschutz
Zielobjekte für Schutzbedarfsfeststellung
- Daten
- datenverarbeitende Prozesse, Anwendungen, Systeme
- Kommunikationsverbindungen
- Räume
Schutzziele (= Grundwerte)
- Verfügbarkeit
- Vertraulichkeit
- Integrität
Schadensszenarien
- Beeinträchtigungen der persönlichen Unversehrtheit
- Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge
- Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts
- Beeinträchtigungen der Aufgabenerfüllung
- negative Innen- oder Außenwirkung
- finanzielle Auswirkungen
Schutzbedarfskategorien
- Normaler Schutzbedarf
- Hoher Schutzbedarf
- Sehr hoher Schutzbedarf
Risikokategorien
- Geringes Risiko
- Mittelmäßiges Risiko
- Hohes Risiko
- Sehr hohes Risiko
Definition Schutzbedarfskategorien
Schadensszenario x Schutzbedarfskategorie
z.B.
| Normaler Schutzbedarf | Hoher Schutzbedarf | Sehr hoher Schutzbedarf | |
|---|---|---|---|
| - mögliche Beeinträchtigungen der persönlichen Unversehrtheit | nein | nicht stark/dauerhaft | stark/dauerhaft |
| - mögliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge | geringfügige Strafen | schwerwiegende/hohe Strafen | existenzbedrohende Strafen |
| - mögliche Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts | geringfügige/tolerierbare Auswirkungen für Betroffenen | Beeinträchtigungen, aber ohne dauerhaften Folgen | stark/dauerhaft |
| - mögliche Beeinträchtigungen der Aufgabenerfüllung | allenfalls unerheblich | erhebliche Beeinträchtigung; Ausfallzeiten >24h nicht tolerierbar | starke Beeinträchtigung; Ausfallzeiten >2h nicht tolerierbar |
| - mögliche negative Innen- oder Außenwirkung | kein Ansehensverlust bei Kunden und Geschäftspartnern | Ansehen bei Kunden/Geschäftspartnern wird erheblich beeinträchtigt | Ansehen bei Kunden/Geschäftspartnern wird grundlegend und nachhaltig beschädigt |
| - möglicher finanzieller Schaden | geringfügig (< XXX €) | schwerwiegende/hoch (< YYYYYY €) | existenzbedrohend (>= YYYYYY €) |
Schutzbedarf
BSI Checkliste für das Interview zur Schutzbedarfsfeststellung
Schutzbedarfsmatrix
Zielobjekte x Schutzziele x Schadensszenarien x Schutzbedarfskategorie
| Beurteilung möglichen Schadens | Normaler Schutzbedarf | Hoher Schutzbedarf | Sehr hoher Schutzbedarf | |
|---|---|---|---|---|
| Verfügbarkeit (Ausfall) | ||||
| - mögliche Beeinträchtigungen der persönlichen Unversehrtheit | ja? stärk? dauerhaft? | |||
| - mögliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge | Strafhöhe? | |||
| - mögliche Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts | stärke? dauerhaft? | |||
| - mögliche Beeinträchtigungen der Aufgabenerfüllung | Beeinträchtigungsstärke? | |||
| - akzeptable Ausfallzeit | Stunden | |||
| - mögliche negative Innen- oder Außenwirkung | erheblich? grundlegend? nachhaltig? | |||
| - möglicher finanzieller Schaden | € | |||
| Vertraulichkeit (Datenleak) | ||||
| - mögliche Beeinträchtigungen der persönlichen Unversehrtheit | ja? stärk? dauerhaft? | |||
| - mögliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge | Strafhöhe? | |||
| - mögliche Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts | stärke? dauerhaft? | |||
| - mögliche Beeinträchtigungen der Aufgabenerfüllung | Beeinträchtigungsstärke? | |||
| - mögliche negative Innen- oder Außenwirkung | erheblich? grundlegend? nachhaltig? | |||
| - möglicher finanzieller Schaden | € | |||
| Integrität (Kompromittierung) | ||||
| - mögliche Beeinträchtigungen der persönlichen Unversehrtheit | ja? stärk? dauerhaft? | |||
| - mögliche Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften oder Verträge | Strafhöhe? | |||
| - mögliche Beeinträchtigungen des informationellen Selbstbestimmungsrechts | stärke? dauerhaft? | |||
| - mögliche Beeinträchtigungen der Aufgabenerfüllung | Beeinträchtigungsstärke? | |||
| - mögliche negative Innen- oder Außenwirkung | erheblich? grundlegend? nachhaltig? | |||
| - möglicher finanzieller Schaden | € |
Für normalen Schutzbedarf:
- IT-Grundschutzhandbuch -> IT-Grundschutz-Kataloge -> IT-Grundschutz-Kompendium
Zusätzlicher Analysebedarf falls:
- Ein Zielobjekt hat einen hohen oder sehr hohen Schutzbedarf in mindestens einem der Schutzziele
- Es gibt für ein Zielobjekt keinen hinreichend passenden Baustein im IT-Grundschutz-Kompendium
Risikoanalyse
Zusätzlicher Analysebedarf in folgenden Fällen:
- Ein Zielobjekt hat einen hohen oder sehr hohen Schutzbedarf in mindestens einem der drei Grundwerte Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit.
- Es gibt für ein Zielobjekt keinen hinreichend passenden Baustein im IT-Grundschutz-Kompendium.
- Es gibt zwar einen geeigneten Baustein, die Einsatzumgebung des Zielobjekts ist allerdings für den IT-Grundschutz untypisch.
- Gefährdungsübersicht erstellen
- Risiken einstufen
- Risiken behandeln
- Sicherheitskonzept konsolidieren
Organisatorische Rahmenbedingungen
Zielobjekte zusammenstellen
47 Elementare Gefährdungen
Gefährdungsübersicht anlegen
Gefährdungsübersicht ergänzen
Häufigkeit und Auswirkungen einschätzen
Häufigkeit
- selten
- mittel
- häufig
- sehr häufig
Auswirkungen
- vernachlässigbar
- begrenzt
- beträchtlich
- existenzbedrohend
Risiken bewerten
Risiken behandeln
nächste Schritte:
Konsolidierung des Sicherheitskonzepts
Umsetzungsplanung
Fortführung des Sicherheitsprozesses
Praxisbeispiele
Bahn Abfahrtsmonitor
Stadionanzeigetafel
Behörden
Software-Update für Streifenwagen
Polizeifunk
Notrufnummern
Rating Agentur .
Heizungssteuerung
Gas Pipeline .
AKW Fernwartung
Zentrifugen
Flughafen-Brandmeldeanlage
Runway Visual Range (RVR) information . .
Raumfahrt
Ariane Lagereglung .
Mars Climate Orbiter .
Marine
Feuerleitsysteme
SMCS NG (Submarine Command System New Generation)
Supply Chain Security
Supply chain system failures @Iraq
Exploding pagers
Linux Says “Goodbye, Russia"
Globale Überwachung und Spionage?!
Aktuell
Volksdaten von Volkswagen
Elektronische Patientenakte . .
Wahlsoftware .
SOL
Wählen Sie ein aktuelles IT-Großprojekt aus, informieren Sie sich darüber und beantworten Sie in Stichpunkten die folgenden 6 Fragen:
- Beschreiben sie das gewählte IT-Projekt. Welches Ziel soll durch die IT-Lösung umgesetzt werden?
- Welche Daten werden in dem Projekt verarbeitet? Skizzieren sie grob die Systemarchitektur.
- Welche der 3 Schutzziele bewerten Sie für die verarbeiten Daten als besonders wichtig?
- Für welche der 6 Schadensszenarion sehen sie einen hohen oder sehr hohen Schutzbedarf?
- Welche der 47 Elementaren Gefährdungen sind aus ihrer Sicht für das Beispiel besonders relevant?
- Welche Schwachstellen / Verwundbarkeiten / Exploits sind Ihnen bekannt?
Hinweise:
- Sie können für die SOL eins der folgenden IT-Großprojekte oder ein anderes selbst gewählten Projekt wählen:
- Ziel der SOL ist es, sich in mit dem gewählten Thema / IT-Großprojekt ausreichend zu beschäftigen, um im Unterricht gemeinsam eine Schutzbedarfs- und Risikoanalyse durchführen zu können.
- Auf Wunsch können die Ergebnisse der SOL in einem kurzen Vortrag (benotet) vorgestellt werden.
- Gruppenarbeit ist erlaubt.
- Rückfragen zur SOL sind am Montag dem 13.1. möglich. Die Abgabe (Hochladen von Stichpunkten in Ilias) soll vor dem Unterricht am Mittwoch (15.1.) erfolgen.
Handlungsempfehlung
„erweiterte Machbarkeitsanalyse“
flowchart TD
S[Start] --> Lösenswert{Ist die Aufgabe lösenswert?}
Lösenswert -->|Ja| Ressourcen{Reichen die zur Verfügung gestellten Ressourcen?}
Lösenswert -->|Nein| Ablehnen
Ressourcen -->|Ja| Fähigkeiten{Reichen die Fähigkeiten von mir?}
Ressourcen -->|Nein| Nachverhandeln --> Erfolgreich{Nachverhandlung erfolgreich?}
Erfolgreich -->|Ja| Ressourcen
Erfolgreich -->|Nein| Ablehnen
Fähigkeiten -->|Ja| Akzeptieren[Aufgabe akzeptieren]
Fähigkeiten -->|Nein| Ablehnen[Aufgabe ablehnen]
Planung
„Ein funktionierendes Sicherheitsmanagement muss in die existierenden Managementstrukturen jeder Institution eingebettet werden.
Daher ist es praktisch nicht möglich, eine für jede Institution unmittelbar anwendbare Organisationsstruktur für das Sicherheitsmanagement anzugeben.
Vielmehr werden häufig Anpassungen an spezifische Gegebenheiten erforderlich sein“
[ISMS.1 Sicherheitsmanagement]
IT-Grundschutz
BSI-Standards
BSI-Standard 200-1: Managementsysteme für Informationssicherheit (ISMS)
- orientiert sich an ISO 27001
- enthällt u.A. Empfehlungen für:
- Erstellung des Sicherheitskonzepts
- Umsetzung des Sicherheitskonzepts
- Erfolgskontrolle des Sicherheitskonzepts
- Kontinuierliche Verbesserung des Sicherheitskonzepts
BSI-Standard 200-2: IT-Grundschutz-Methodik
- methodische Hilfestellungen zur schrittweisen Einführung eines ISMS
- effiziente Verfahren
- konkretisiert allgemeine Anforderungen aus BSI-Standard 200-1
- enthällt u.A. Empfehlungen für:
- Basis-Absicherung
- breite, grundlegende Erst-Absicherung
- Kern-Absicherung
- besonders gefährdete Geschäftsprozesse und Assets vorrangig absichern
- Standart-Absicherung
- umfassende, tiefgehende Abgesicherung (klassischen IT-Grundschutz-Vorgehensweise)
- Verantwortlicheiten, z.B.
- Informationssicherheitsbeauftragte
- Datenschutzbeauftragte
- Geschäftsführung/Management
- externe Sicherheitsexperten
- ISO 27001 Zertifizierung
- Basis-Absicherung
„Die umfangreichen Informationen rund um IT-Grundschutz ersetzen nicht den gesunden Menschenverstand.
Informationssicherheit zu verstehen, umzusetzen und zu leben, sollte Priorität haben.
Das IT-Grundschutz-Kompendium bietet zu vielen Aspekten eine Menge an Informationen und Empfehlungen.
Bei deren Bearbeitung sollte immer im Auge behalten werden, dass aus diesen die für die jeweilige Institution und ihre Rahmenbedingungen geeigneten Sicherheitsanforderungen ausgewählt und angepasst werden. […]
Weder die Anforderungen der Bausteine des IT-Grundschutz-Kompendiums noch die Maßnahmen der Umsetzungshinweise sollten als pure Checklisten zur Statusfeststellung genutzt werden, sondern mit Augenmaß an die individuellen Bedingungen angepasst werden.“
[BSI-Standard 200-2: IT-Grundschutz-Methodik]
BSI-Standard 200-3: Risikoanalyse auf der Basis von IT-Grundschutz
- vereinfachtes Verfahren zur Risikoanalyse
- zielgerichtet, „leicht“ anzuwenden, anerkannt
- hilfreich, wenn Komponenten abzusichern sind, bei denen fraglich ist, ob die Erfüllung von Basis- und Standard-Anforderungen für eine ausreichende Sicherheit genügt
- enthällt u.A. Empfehlungen für:
- Erstellung einer Gefährdungsübersicht
- Risikoeinstufung
- Behandlung von Risiken
- Konsolidierung des Sicherheitskonzepts
IT-Grundschutz-Kompendium
47 Elementare Gefährdungen -> IT-Grundschutz-Bausteine
Prozess-Bausteine (Organisatorische Maßnahmen)
- ISMS: Sicherheitsmanagement
- ORP: Organisation und Personal
- CON: Konzepte und Vorgehensweisen
- OPS: Betrieb
- DER: Detektion und Reaktion
System-Bausteine (Technische Maßnahmen)
- APP: Anwendungen
- SYS: IT-Systeme
- IND: Industrielle IT
- NET: Netze und Kommunikation
- INF: Infrastruktur
Checklisten zum IT-Grundschutz
| Baustein | Typ | Entbehrlich | Begründung für Entbehrlichkeit | Umsetzung | Umsetzung bis | Verantwortlich | Bemerkungen / Begründung für Nicht-Umsetzung | Kostenschätzung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID+Titel+Inhalt | Basis/Standart/Hoch | Ja/Nein | … | Ja/Teilweise/Nein | Datum | … | … | … |
Endpoint Security
IT-Grundschutz-System-Bausteine SYS
- SYS.1.1 Allgemeiner Server
- SYS.1.2.3 Windows Server
- SYS.1.3 Server unter Linux und Unix
- SYS.1.5 Virtualisierung
- SYS.1.6 Containerisierung
- SYS.1.8 Speicherlösungen
- SYS.2.1 Allgemeiner Client
- SYS.2.2.3 Clients unter Windows
- SYS.2.3 Clients unter Linux und Unix
- SYS.2.4 Clients unter macOS
SOL:
- Beschreiben Sie ein einfaches IT-System, dass sie auf Basis des IT-Grundschutzes absichern möchten.
- Wie schätzen Sie den Schutzbedarf für das System ein?
Hinweis: Für die SOL wird keine vollständige Schutzbedarfsfeststellung erwartet.- Begründen Sie, ob ein zusätzlicher Analysebedarf besteht, so dass eine Risikoanalyse durchgeführt werden sollte.
- Wählen Sie die auf das abzusichernde System zutreffenden System-Bausteine aus dem IT-Grundschutz-Kompendium aus.
- Verstehen Sie die für ihr System relevanten Bausteine.
- Laden Sie sich die passende(n) Checkliste(n) herunter.
- Füllen Sie die in der Checkliste die Spalten „Entbehrlich“ und „Begründung für Entbehrlichkeit“ aus.
Physische Absicherung von Endgeräten
Verschlüsselung von Datenträgern (und Datenübermittlung)
Zugriffsregelung
- Sichere Passwörter
- 2FA
- Sperren bei Inaktivität
Backups
Firewall
IDS/IPS
Virenscanner
Schulungen
Trennung von (von OS- und DB-) Benutzerverwaltung
Softwareinstallation/Updates planen
Netzwerksicherheit
Zero Trust Security / Zero Trust Architektur (ZTA) / Zero Trust Network Access (ZTNA)
SSL/TLS (vereinfacht)
TR-02102-2 „Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen“ Teil 2 – Verwendung von Transport Layer Security (TLS)
sequenceDiagram
participant Client
participant Server
Note right of Client: Kennt Publik Keys von Root-CAs
Client->>Server: Verbindungsanfrage
Note left of Server: Hat Asymmetrisches Schlüsselpaar
Note left of Server: Publik Key ist via Zertifikatskette von Root-CA unterschrieben
Server->>Client: Übergabe des Publik Keys + Zertifikatskette
Client->>Client: Überprüfung des Zertifikats mit CA Publik Key
Client->>Client: Generierung AES Session Key *
Client->>Client: Verschlüsselung des AES Session Key mit dem Publik Key des Servers
Client->>Server: Übertragung des verschlüsselten AES Session Keys
Server->>Server: Entschlüsselung AES Session Keys
Server->Client: mit AES Session Key verschlüsselte Datenübertragung
IHK-Prüfung Winter 2021/22
IKH-Prüfung IDS HTTPS-Entschlüsselung
Firewalls
NAT
(NetworkAddressTranslation) -> NAPT (NetworkAddressPortTranslation)
- SNAT (SourceNAT) / Masquerading
- DNAT (DestinationNAT)
- …
- Full NAT
- 1:1 NAT
- No NAT
echo 1 | sudo tee /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
IHK Abschlussprüfung Winter 2023/24 Analyse+Entwicklung Aufgabe 2
VLAN
-
Access-Mode, Trunk-Mode, Hybrid-Mode
-
Zuweisung z.B. auf Basis von
- Anschluss-Port
- MAC
- IP
- IP + TCP/UDP-Port
- Authentifizierung mit Zertifikaten
| Schicht | Administrationsaufwand | Flexibilität | Sicherheit |
|---|---|---|---|
| 1 | + | - | - |
| 2 | (-) | (-) | - |
| 3 | (-) | + | - |
| 4 | (-) | + | (-) |
| 5-7 | (-) | + | (+) |
### Vorbereitung:
lsmod | grep 8021q
sudo modprobe 8021q
### Virtuelles Interface für VLAN-ID 200 anlegen:
sudo ip link add link wlan0 name wlan0.200 type vlan id 200
IHK Abschlussprüfung Winter 2023/24 Analyse+Entwicklung Aufgabe 3
VPN
Proxy
- Caching
- Filtern -> Verfügbarkeit (+ Versuch des Schutzes vor schädlichen Inhalten)
- Kontrolle -> Vertraulichkeit
- Manipulation -> Integrität
ReverseProxy
SSL-Offloading/TLS-Termination
Radius
- „AAA“
- Authentication
- Authorization
- Accounting
Firewalls
Strategien
Whitelist („Allowlist-Strategie“)
- „
Diese Variante ist sehr sicher.“ Dise Stragegie ist die einzige, die für die meisten Anwendungsfälle einen relevanten Sicherheitsvorteil bietet. - Ein Packetfilter mit Whitelist-Strategie sollte auf jedem System eingesetzt werden.
- „Allerdings erfordert sie eine (aufwendige) Konfiguration der Firewall.“ (?)
Blacklist („Blocklist-Strategie“)
- „Diese Variante ist relativ komfortabel. Bei der Einführung ist mit
keinerleiwenigen Problemen zu rechnen.“ - „Allerdings ist sie nur so sicher, wie Gefahren und Sicherheitslöcher bekannt sind und gesperrt werden.“ :(
Arten
Paketfilter
- einfach
- hoher Datendurchsatz
- untersucht einzelne Daten„pakete“
- Layer 3 (und teilweise Layer 4 und Layer 2)
Stateful-Packet-Inspection (SPI)
- untersucht Daten„ströme“ (zusammengehörende „Pakete“)
- überwiegend für Layer 4 (TCP)
Application-Layer-Firewall (Content-Filter)
- „Application-Gateway“, „Application-Level-Gateway“
- Auf Layern 5-7
- „
intelligenter“ Behauptet intelligenter als Paketfilter+SPI zu sein - Datendurchsatz relativ niedrig
Bewerten Sie folgende Anwendungsfälle:
- „Herausfiltern von ActiveX und/oder JavaScript aus angeforderten HTML-Seiten“
- „Blockieren von Viren oder Trojanern in Webseiten“
- „Filtern von vertraulichen Firmeninformationen (z.B. Bilanz)“
- „Sperren von unerwünschten Webseiten anhand von Schlüsselwörtern“
- „Unerwünschte Anwendungsprotokollen (Filesharing) blockieren“
- meist nur Blacklist
- verhindert Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
Next Generation Firewall
-
Zusatzfunktionen
- Deep Packet Inspection (DPI)
- IPS oder IDS
-
Bringt viele Herausforderungen
- Integrität, Vertraulichkeit, Verfügbarkeit
- Datenschutz
- komplexe Konfiguration, Debuggen, Kosten
- maschinelle Lernverfahren
Web Application Firewall (WAF)
Beispiel: Anomaly Scoring in ModSecurity
Beispiel: iptables
Beispielkonfiguration für Clients
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT
iptables -A INPUT -m state --state NEW,ESTABLISHED -j ACCEPT
iptables -P INPUT DROP
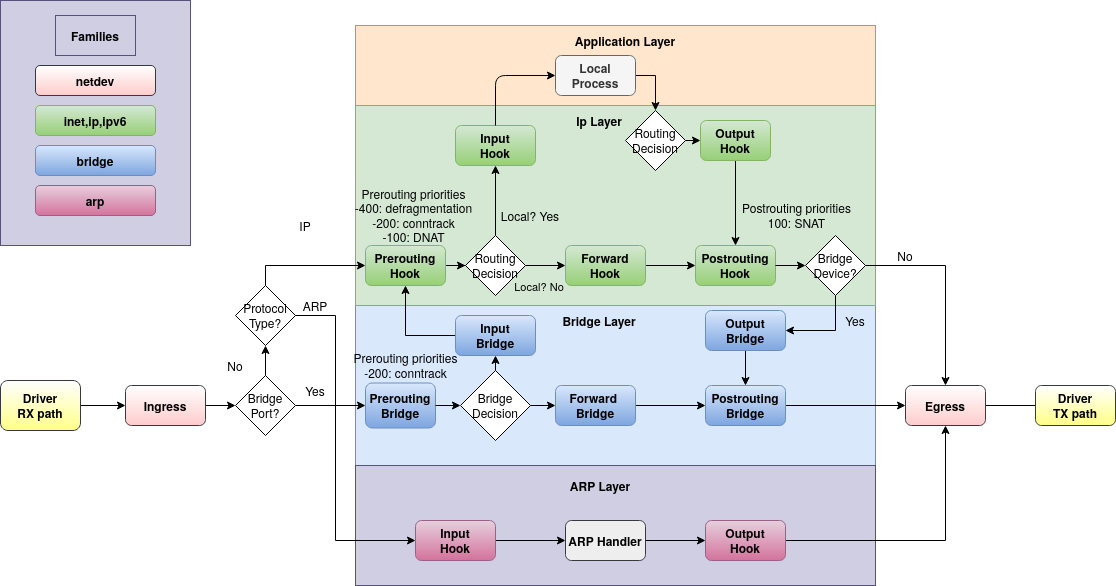
Mehr Details: Einfuhrung in nftables
VPN
„virtuelles privates Netzwerk“
Netzwerktunnel / Overlay-Netzwerk
Die unteren Schichten des OSI-Modells werden als „Transportnetz“ verwendet um darüber andere Protokolle zu sprechen. In VPNs (Tunneln und allgemein in Overlay-Netzwerken) ist es üblich, dass Protokolle aus normalerweise niedrigeren Layern über Protokolle höherer Layer transportiert werden.
flowchart LR A<-->B subgraph A[Host 1] a7[7]-.-a6 a6[6]-.-a5 a5[5]-.-a4 a4[4]-.-a3 a3[3]-.-a2[2] end subgraph a2[TAP] at4[4]-.-at3 at3[3]-.-at2 at2[2]-.-at1[1] end subgraph B[Host 2] b7[7]-.-b6 b6[6]-.-b5 b5[5]-.-b4 b4[4]-.-b3 b3[3]-.-b2[2] end subgraph b2[TAP] bt4[4]-.-bt3 bt3[3]-.-bt2 bt2[2]-.-bt1[1] end
VPNs laufen häufig auf den Layern 3, 4 oder 5 des Transportnetzes und können dementsprechend zur Datenübertragung auf dem Layer 2, 3 oder 4 des Transportnetzes aufbauen. Nutzdaten werden beispielsweise mittels Ethernet-Frames, IP-Packet oder UDP-Datagram/TCP-Segment transportiert.
TUN/TAP (bzw. Virtual Tunnel Interface)
Für die Nutzung von VPNs wird als Schnittstelle für andere Anwendungen häufig eine virtuelle Netzwerkschnittstelle bereitgestellt.
Diese arbeiten üblicherweise auf Layer 3 (TUN-Device) oder Layer 2 (TAP-Device). In der Cisco-Welt wird statt dessen von „Virtual Tunnel Interface“ (VTI) gesprochen.

Manche VPN-Protokolle (z.B. IPSec) sind so tief im Betriebssystem eingebaut, dass sie Routing ohne zusätzliche virtuelle Netzwerkschnittstellen erlauben.
VPN Protokolle
WireGuard
- Performance
OpenVPN
- Verbreitet
- Flexibel, Einfach
SSH
- Minimallösung
Virtual eXtensible LAN (VXLAN)
- Layer-2
- Alternative zu L2TP
- Unverschlüsselt!
- Verwendung häufig in Kombination mit IPSec
Sonstige
Layer 2 Tunneling Protocol (L2TP)
- Unverschlüsselt!
- PPTP + L2F
Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)
- Unsicher!
Layer 2 Forwarding (L2F)
- Unverschlüsselt!
IPSec
- Layer-3
- verbreitung im Umfeld von Cisco + Windows
- benötigt 2 Public IPs (bzw. Erweiterung für NAT)
- Komplexität
- sehr viele RFCs
TR-02102-3 „Kryptographische Verfahren: Empfehlungen und Schlüssellängen“ Teil 3 – Verwendung von Internet Protocol Security (IPsec) und Internet Key Exchange (IKEv2)
Verbindungsaufbau
Security Association (SA)
- Austausch von Sicherheitsparametern
- IKE-Version
- ESP oder AH
Internet-Key-Exchange-Protokoll (IKE)
- verwendet Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch
- IKEv1 oder IKEv2 (Verfügbarkeit herstellerabhängig)
Authentication Header (AH) und Encapsulating Security Payload (ESP)
- können einzeln oder gemeinsam genutzt werden
- AH: Authentizität, Integrität; aber nicht Vertraulichkeit
- ESP: Vertraulichkeit, (optional) Authentizität und Integrität
- ESP heute deutlich verbreiteter
Transport- und Tunnelmodus
- Andere VPN-Protokolle unterscheiden nicht zwischen Point-to-Point / Point-to-Site / Site-to-Site
- VPN-Endpunkte können auch Router und damit Sites sein
- Viele VPN-Server sind Multipoint-fähig (akzeptieren Verbindung von mehreren Clients)
Implementierung
Prüfen
Schwachstellenanalyse
-
IST-Analyse
-
Vergleich mit Soll-Zustand
-
Risikobewertung
=> potenzielle Bedrohung
Beweisen vs. Testen
Penetrationstests
„Hacking-Tools“
Vulnerability Scanners
Computer Forensics
Reverse Engineering
Security Research
Beispiele
nmap / nmapsi4 / Zenmap
tshark / Wireshark
tcpdump
sudo tcpdump -i lo -nnSX port 3333
Postman
Goss server validation
Security Information and Event Management (SIEM) und Extended Detection and Response (XDR)
z.B. Wazuh